Nutrias in Deutschland – zwischen Niedlichkeit und Naturschutzproblem
- Marco Papajewski
- 3. Nov. 2025
- 3 Min. Lesezeit
Sie sehen aus wie kleine Biber, haben ein weiches Fell und wackeln mit charmantem Appetit durch unsere Stadtparks: Nutrias in Deutschland. Kaum ein Spaziergang an Flüssen oder Teichen vergeht, ohne dass man die südamerikanischen Nagetiere zu Gesicht bekommt.Doch hinter der niedlichen Erscheinung steckt ein komplexes ökologisches Thema. Ursprünglich wurden Nutrias – auch Biberratten genannt – im 19. Jahrhundert für die Pelzindustrie nach Europa gebracht. Als der Markt für Pelz einbrach, entkamen viele Tiere aus Farmen oder wurden freigelassen. Seitdem haben sie sich erstaunlich erfolgreich in Deutschland ausgebreitet.
Wie man Nutrias vom Biber unterscheidet
Auf den ersten Blick könnte man die Nutria leicht mit dem heimischen Biber verwechseln. Beide leben am Wasser, beide haben orangefarbene Schneidezähne und ein dichtes Fell. Der Unterschied liegt jedoch im Detail – und er ist ökologisch bedeutsam.
Aussehen: Nutrias sind kleiner (rund 60 cm plus Schwanz) und haben einen langen, runden, unbehaarten Schwanz. Der Biber hingegen kann über einen Meter lang werden und besitzt den charakteristischen, breiten „Paddelschwanz“.
Lebensweise: Während der Biber ein echter Baumeister ist, der ganze Gewässerlandschaften mit Dämmen und Burgen gestaltet, begnügt sich die Nutria mit Erdhöhlen in Uferböschungen oder einfachen Nestern aus Pflanzenmaterial.
Ernährung: Nutrias fressen vor allem weiche Wasserpflanzen, Wurzeln und Gemüse – gelegentlich auch Getreide von Feldern. Biber hingegen sind auf Gehölze spezialisiert und nagen an Rinde und Ästen.
Herkunft: Der wohl wichtigste Unterschied: Der Biber ist ein streng geschütztes, heimisches Tier, das durch Wiederansiedlungsprogramme mühsam zurückgekehrt ist. Die Nutria dagegen ist ein sogenannter Neozoon – also eine gebietsfremde Art, die sich in unserer Natur etabliert hat.
Nutrias in deutschen Großstädten
Kaum ein Tier hat sich so erfolgreich an das Stadtleben angepasst wie die Nutria. Ob in Hannover am Maschsee, in Berlin an der Spree oder in Wiesbaden am Kurparkteich – überall sind sie zu Hause. Doch warum fühlen sie sich dort so wohl? In Städten ist es wärmer und das Mikroklima sorgt dafür, dass selbst kalte Winter selten zum Problem werden.
Gerade Menschen sind jedoch einer der Hauptgründe, denn nicht selten ist eine Zufütterung Hauptgrund für eine Verbreitung – oft aus falsch verstandener Tierliebe, aber mit fatalen Folgen. Brot, Mais oder Karottenreste locken Nutrias in großer Zahl an und fördern eine unnatürliche Vermehrung.
Auch bieten Stadtgewässer wie Kanäle, Teiche oder Entwässerungsgräben ideale Rückzugsorte. Die Kehrseite: Wo sich viele Nutrias ansiedeln, leiden oft die Uferbefestigungen und die Vegetation. Ihre Baue untergraben Wege und Dämme und ihre Fraßspuren verändern Pflanzenbestände. In einigen Städten gibt es daher Fütterungsverbote und Versuche, die Population zu kontrollieren – ein Balanceakt zwischen Naturschutz, Tierschutz und öffentlicher Sicherheit.

Ökologische Auswirkungen
So friedlich und zutraulich Nutrias auch wirken – ihre Anwesenheit bleibt nicht ohne Folgen. Durch ihre Bau- und Fraßtätigkeit verändern sie ganze Uferlandschaften und greifen in empfindliche ökologische Systeme ein. Besonders dort, wo sich viele Tiere ansiedeln, geraten natürliche Gleichgewichte schnell aus dem Takt. Was für Spaziergänger ein niedlicher Anblick ist, kann für Naturschützer und Städteplaner zu einer echten Herausforderung werden – denn die Auswirkungen auf Böden, Pflanzen und Gewässer sind vielfältig:
Erosion und Uferzerstörung: Nutrias graben weit verzweigte Baue in Böschungen. Das kann Wege, Brückenfundamente und Dämme unterhöhlen. Besonders an künstlichen Gewässern ist das ein ernstes Problem.
Veränderung der Pflanzenwelt: Durch ihren intensiven Pflanzenfraß verschwinden vielerorts seltene Uferpflanzen. Wo Nutrias dominieren, bleibt oft nur eine monotone Vegetation zurück.
Einfluss auf andere Tiere: Nutrias konkurrieren mit Enten, Blässhühnern oder Fröschen um Nahrung und Lebensraum. Indirekt verändern sie so ganze ökologische Gemeinschaften.
Nährstoffeintrag und Wasserqualität: Futterreste, Exkremente und aufgewühlter Schlamm führen zu höherem Nährstoffgehalt im Wasser – ein Nährboden für Algenblüten.
Landwirtschaftliche Schäden: An Flussniederungen und Feldern fressen sie Getreide und Mais, beschädigen Drainagen und Bewässerungsgräben.
Trotz dieser Probleme sind sie fester Bestandteil unserer heutigen Landschaft. Der Umgang mit ihnen bleibt ein Dilemma: Einerseits sind sie faszinierende Anpassungskünstler, andererseits bedrohen sie empfindliche Ökosysteme.

Zwischen Faszination und Verantwortung
Nutrias verkörpern die Widersprüchlichkeit des modernen Naturschutzes: Sie sind niedlich, zutraulich und leicht zu mögen – aber ihr Erfolg bringt die Natur aus dem Gleichgewicht. Ein verantwortungsvoller Umgang heißt daher nicht, sie zu verteufeln, sondern informiert zu handeln:
Nicht füttern, um unkontrollierte Vermehrung zu vermeiden.
Lebensräume schützen, in denen heimische Arten Vorrang haben.
Aufklärung fördern, damit Tierliebe und Naturschutz kein Widerspruch sind.
So bleibt die Begegnung mit einer Nutria am Flussufer das, was sie sein sollte: ein faszinierender Blick auf ein Tier, das uns zeigt, wie flexibel Leben sein kann – und wie wichtig es ist, im Gleichgewicht mit der Natur zu bleiben.
Nutrias zeigen eindrucksvoll, wie flexibel Tiere auf menschlich veränderte Lebensräume reagieren.
Sie nutzen unsere Städte, Flüsse und Parks – und halten uns gleichzeitig einen Spiegel vor: Wo die Natur Platz findet, findet sie Wege. Doch wir entscheiden, ob dieses Zusammenleben geordnet, respektvoll und nachhaltig verläuft.





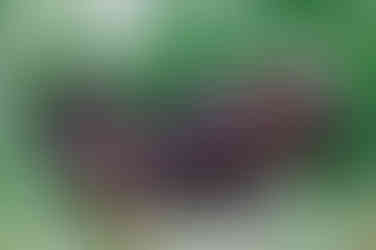













Nutrias sorgen in Deutschland für Diskussionen, weil possierliche Optik oft Konflikte mit Naturschutzanforderungen überlagert. Viele Regionen melden zunehmende Schäden an Ufern, Pflanzenbeständen sowie landwirtschaftlichen Flächen. Trotzdem bleibt Umgang mit Nutrias komplex, da Bevölkerung häufig Sympathie entwickelt. Informative Blogs helfen, Problem besser zu verstehen und praktikable Lösungen zu erkennen. Besonders spannend wirkt Austausch lokaler Akteure, Kommunen, Naturfreunde. Wer zusätzliche Kontakte sucht, findet über Branchenbuch Schirmitz hilfreiche Hinweise. Zusätzlich lohnt Austausch mit Forschungsteams, um neuartige Methoden zur Bestandskontrolle zu prüfen und langfristige Strategien für nachhaltiges Zusammenleben zu entwickeln für Projekte.